
In der Technik und anderen Wissenschaften stellt sich häufig die Frage, welche Auswirkungen die Kombination zweier oder mehrerer unabhängiger Quellen hat. Dies wird oft grafisch als Interaktionsdiagramm dargestellt. In diesem Blog-Beitrag zeigen wir einige Beispiele für Interaktionsdiagramme und besprechen deren Hintergrund.
Inhaltsverzeichnis
- Biegung und Spannung eines Trägers
- Potenzgesetz
- Befestigungselemente
- Versagenskriterium von Tresca
- Trägersäule, überarbeitet
- Dekohäsion
- Ermüdung
- Sicherheitsfaktoren
- Isobologramme
- Abschließende Bemerkungen
Biegung und Spannung eines Trägers
Als einführendes Beispiel betrachten wir die Bruchlast eines Balkens, der sowohl einer Axialkraft als auch einem Biegemoment ausgesetzt ist. Es wird ein elastoplastisches Material wie Stahl angenommen, das in Zug und Druck identische Eigenschaften aufweist, sowie ein Träger mit einem rechteckigen Querschnitt der Höhe 2a und der Breite 2b. Als Fehlerkriterium wird ideale Plastizität mit einer Fließspannung \sigma_{\mathrm y} verwendet.
Beim Versagen ist die Spannung über den gesamten Querschnitt gleich der Fließspannung, entweder in Zug- oder in Druckspannung. Die Spannungsverteilung lässt sich wie folgt darstellen:
 Spannungsverteilung im Versagenszustand.
Spannungsverteilung im Versagenszustand.
Hier ist e der Abstand von der Mittelachse zum Ort des Lastwechsels (der neutralen Linie).
Das Gleichgewicht zwischen der Spannungsverteilung auf der einen Seite und der aufgebrachten Axialkraft N und dem Biegemoment M auf der anderen Seite ergibt
und
Es ist sofort erkennbar, dass sich die maximalen lasttragenden Kapazitäten, N_{\mathrm f} und \displaystyle M_{\mathrm f}, ergeben, wenn jeweils e = a und e = 0 ist:
und
wobei A die Querschnittsfläche und Zp das sogenannte „plastische Widerstandsmoment“ („Plastic Section Modulus“) ist.
Häufig werden diese Ausdrücke in einer dimensionslosen Form geschrieben:
und
In diesem Fall lässt sich der Parameter e leicht eliminieren, sodass eine explizite Beziehung ermittelt werden kann:
oder gleichermaßen
Dieser Ausdruck ergibt die Kombinationen von Kraft und Moment, die zum Versagen des Balkenquerschnitts führen. Eine solche Beziehung wird häufig in Form eines Interaktionsdiagramms dargestellt. Die Gleichung oder die entsprechende Grafik kann zur schnellen Bewertung der zulässigen Zustände verwendet werden.
 Interaktionskurve für einen rechteckigen Stahlträger.
Interaktionskurve für einen rechteckigen Stahlträger.
Bei dimensionslosen Interaktionsgesetzen ist es üblich, die Versagenskurve als f( \xi, \eta ) = 1 auszudrücken, sodass f( \xi, \eta ) < 1 den sicheren Bereich kennzeichnet. Für das Beispiel der Balkenbiegung gilt \eta + \xi^2 = 1.
Potenzgesetz
Viele Interaktionsregeln sind einem Potenzgesetz zuzuordnen. Mathematisch bedeutet dies, dass
Die Exponenten \alpha und \beta müssen nicht unbedingt ganze Zahlen sein, auch wenn die Werte eins und zwei häufig vorkommen. Oft gilt \alpha = \beta. In diesem Fall ist die Regel symmetrisch in Bezug auf die beiden Parameter. Dies ist jedoch nicht immer der Fall; das ursprüngliche Beispiel mit dem Träger ist ein Fall von \alpha \neq \beta.
Bei einem Potenzgesetz tritt der Maximalwert für einen Parameter immer dann auf, wenn der andere Parameter null ist. Dies scheint intuitiv offensichtlich, doch in diesem Blog-Beitrag werden wir auch ein Gegenbeispiel vorstellen.
Ein Sonderfall eines Potenzgesetzes, \alpha = \beta = 1, führt zu einer rein additiven Wechselwirkung, die durch eine gerade Linie dargestellt werden würde. Bei einer Anwendung von 40 % des kritischen Werts für eine Last können 60 % der anderen Last angewendet werden.
Befestigungselemente
Eine einfache Analyse von Nieten stellt ein Beispiel für ein Potenzgesetz mit \alpha = \beta = 2 bereit. Nieten können einer Kombination aus Zugkräften (N) und Scherkräften (T) ausgesetzt sein. Die Zugspannung in der Niete beträgt
wobei A die Querschnittsfläche ist. In einem elastischen Zustand hat die Scherspannung eine komplizierte Verteilung über den Querschnitt, aber da wir uns hier hauptsächlich mit dem Versagenszustand befassen, kann von einer gleichmäßigen Verteilung der Scherspannung ausgegangen werden, sodass
Unter Verwendung einer Von-Mises-Vergleichsspannung lautet das Versagenskriterium
Durch Quadrieren beider Seiten und Division durch die Fließspannung lässt sich die Versagensrelation schreiben als
Die einzelnen Versagenslasten sind
und
Die Versagenslast bei Scherung ist eine Auswirkung des angenommenen Von-Mises-Kriteriums.
Das Endergebnis in Bezug auf die Kräfte ist dann
Dies ist ein Beispiel für ein Potenzgesetz mit \alpha = \beta = 2. Solche Gesetze sind üblich, wenn Normen vom Typ „Quadratwurzel der Summe der Quadrate“ verwendet werden, um die verschiedenen Effekte zu kombinieren.
Dies ist jedoch nicht für alle Arten von Verbindungselementen vollständig zutreffend. In älteren Versionen des MIL-HDBK-5H, MILITARY HANDBOOK: METALLIC MATERIALS AND ELEMENTS FOR AEROSPACE VEHICLE STRUCTURES (Ref. 1), wurden mehrere Interaktionsregeln für Schrauben vorgeschlagen. Schrauben sind nicht identisch mit Nieten, aber unter der konservativen Annahme, dass die Reibung zwischen den verbundenen Teilen vernachlässigt wird, ist die Situation ähnlich. Unter Verwendung der Notation aus diesem Dokument (t = Zugspannung; s = Scherspannung) ist
und
Interessanterweise werden alle folgenden Interaktionsregeln benannt:
Die entsprechenden Interaktionsdiagramme sind in der folgenden Abbildung dargestellt.
 Interaktionskurven für verschiedene Schraubeninteraktionsregeln. Die rote Kurve entspricht der Nietentheorie.
Interaktionskurven für verschiedene Schraubeninteraktionsregeln. Die rote Kurve entspricht der Nietentheorie.
Derzeit ist die bevorzugte Version der Interaktionsregel für Schrauben
Wie lässt sich dieser Unterschied zur Nietenanalyse (bei der beide Terme den Exponenten 2 haben) erklären?
Die vorgeschlagene Regel erlaubt eine höhere Belastung, als die Analyse der Nieten nahelegt. Ohne Kenntnis der zugrunde liegenden Überlegungen können nur Vermutungen aufgestellt werden. Ein wichtiger Unterschied besteht darin, dass die Kräfte für die Schrauben nicht durch die Bruchspannung, sondern durch eine „zulässige Kraft“ normiert werden. Die zulässige Kraft in Schrauben basiert auf zwei verschiedenen Bereichen: Die zulässige Zugkraft basiert auf dem Gewindebereich und die zulässige Scherkraft auf dem Schaft. Es handelt sich dabei gewissermaßen um zwei unterschiedliche Mechanismen, die das Versagen bestimmen. Die Querschnittsfläche im Gewindebereich ist deutlich kleiner, etwa um 25 % .
Unter Berücksichtigung dieser Tatsache gibt es eigentlich zwei konkurrierende Kriterien:
- Versagen durch Zugüberlastung des Gewindebereichs
- Versagen durch kombinierte Zug- und Scherbeanspruchung im Schaftbereich
 Bei reiner Zugbelastung ist das Gewinde der schwächste Teil. Bei reiner Scherbelastung ist es der Schaft. Bei einer kombinierten Belastung können beide Stellen kritisch sein.
Bei reiner Zugbelastung ist das Gewinde der schwächste Teil. Bei reiner Scherbelastung ist es der Schaft. Bei einer kombinierten Belastung können beide Stellen kritisch sein.
Im Schaft kann ein Von-Mises-Kriterium verwendet werden. Dort verhält sich die Schraube (unter konservativen Annahmen) wie eine Niete.
Hier ist \kappa das Verhältnis zwischen den Querschnittsflächen des Schafts und des Gewindes. Dies erklärt die Tatsache, dass N_{\mathrm f } in Bezug auf den Gewindebereich definiert ist und die Zugbruchlast im Schaft höher ist.
In dem Gewinde, das keiner Scherung ausgesetzt ist, ist das Versagenskriterium einfach:
Unter Verwendung von \kappa = 1.25 kann das Kriterium folgendermaßen visualisiert werden:
 Vergleich der vorgeschlagenen Interaktionskurve (blau) und einer Zusammensetzung aus Schaft- und Gewindeversagen.
Vergleich der vorgeschlagenen Interaktionskurve (blau) und einer Zusammensetzung aus Schaft- und Gewindeversagen.
Es ist erkennbar, dass die auf von Mises basierende Regel und die Regel R_{\mathrm s}^3 + R_{\mathrm t}^2 = 1 für Fälle, in denen Scherkräfte dominieren, gut übereinstimmen. Für alle Verhältnisse zwischen reiner Zugkraft und reiner Scherkraft ist die letztere Regel eher konservativ. Die Verwendung einer einzigen einfachen analytischen Kurve ist einfacher als die Verwendung der Funktion Piecewise (die für jede Schraubengröße einzigartig wäre, da das Flächenverhältnis κ unterschiedlich ist).
Nachfolgend ist ein Screenshot des Unterknotens Safety unter Fasteners im Interface Shell in der Software COMSOL Multiphysics® dargestellt. Es kann jede Art von Potenzgesetz verwendet werden.
 Einstellungen für die Berechnung von Sicherheitsfaktoren für Befestigungselemente in COMSOL Multiphysics.
Einstellungen für die Berechnung von Sicherheitsfaktoren für Befestigungselemente in COMSOL Multiphysics.
Versagenskriterium von Tresca
Zuvor wurde festgestellt, dass die Verwendung einer Von-Mises-Fließspannung zu einem Potenzgesetz mit
führt. Eine naheliegende Frage lautet daher: Wie wirkt sich die Verwendung eines Tresca-Versagenskriteriums auf die Interaktionskurve aus? In Normen wird häufig das konservativere (aber mathematisch weniger akzeptable) Tresca-Kriterium verwendet.
Die Tresca-Vergleichsspannung ist definiert als die Differenz zwischen der größten und der kleinsten Hauptspannung. Wir können dann auf den Mohr’schen Kreis zurückgreifen, um die Analyse durchzuführen. Bei einer Spannungslage, die aus einer einzigen Direktspannung und einer Scherspannung besteht, ist der Durchmesser des Mohrschen Kreises (2R) auch die Differenz zwischen den beiden Hauptspannungen. Somit ergibt sich für den Kreis, der das Versagen beschreibt,
Nach dem Tresca-Kriterium beträgt die Bruchspannung bei reiner Scherung
Das erstaunliche Ergebnis ist, dass wir genau dieselbe Potenzgesetz-Interaktionskurve wie beim Von-Mises-Kriterium erhalten!
Der einzige Unterschied besteht darin, dass die in dem Ausdruck verwendete Bruchlast für Scherung, {T_{\mathrm f}}, um 13 % kleiner ist, wenn das Tresca-Kriterium angewendet wird.
Überarbeiteter Träger
Stützsäulen werden häufig aus Beton hergestellt. Beton ist ein Werkstoff, dessen Druckfestigkeit sich erheblich von seiner Zugfestigkeit unterscheidet. Die Zugfestigkeit, \sigma_{\mathrm t}, beträgt nur etwa 10 % der Druckfestigkeit, \sigma_{\mathrm c}.
 Spannungsverteilung im Versagenszustand, wenn die Druckspannung höher ist als die Zugspannung.
Spannungsverteilung im Versagenszustand, wenn die Druckspannung höher ist als die Zugspannung.
Eine Wiederholung der ersten Analyse eines rechteckigen Trägers unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Zug- und Druckspannungen ergibt
und
Bevor wir fortfahren, muss eine wichtige Anmerkung gemacht werden: In der Praxis wird Beton immer verstärkt, für gewöhnlich mit Stahlstäben. Eine vollständige Analyse erfordert, dass die Menge der Verstärkung, ihre Platzierung im Querschnitt und ihre Fließspannung berücksichtigt werden. All dies verkompliziert die Algebra erheblich. Die vorliegende vereinfachte Analyse reicht dennoch aus, um die Prinzipien zu veranschaulichen.
Als Referenzbruchlast für Axialkraft können wir den Bruch bei reiner Druckbeanspruchung wählen, also
Als Bruchlast für die Biegung wird das maximal mögliche Moment gewählt. Es ist offensichtlich, dass dies bei e = 0 auftritt, so dass
Es wird ein Parameter \beta für das Verhältnis zwischen Zugfestigkeit und Druckfestigkeit eingeführt, so dass \sigma_{\mathrm t } = \beta \sigma_{\mathrm c }. Außerdem sei e = \epsilon a. Dadurch lassen sich dimensionslose Relationen leichter schreiben. Nun gilt
und
Hier wird die Druckbelastung als positiv angenommen (P = -N). Dies ist eine übliche Konvention für Säulen, da die vorgesehene Belastung überwiegend durch Druck entsteht.
Das Interaktionsdiagramm ist nachfolgend dargestellt für \beta = 0.1 unter Verwendung der Konvention, dass die Kraft auf der vertikalen Achse und das Biegemoment auf der horizontalen Achse dargestellt wird.
 Interaktionsdiagramm für einen Betonbalken.
Interaktionsdiagramm für einen Betonbalken.
In diesem Fall stimmt das maximal zulässige Moment nicht mit einer Axialkraft von Null überein. Wie aus den vorstehenden Ausdrücken hervorgeht, tritt die maximale Momentkapazität auf, wenn
Da \beta klein ist, tritt die maximale Momentkapazität überraschenderweise bei einer Druckkraft von fast 50 % der Bruchlast auf. Aus dem Diagramm lässt sich auch ableiten, dass die Momentkapazität ohne Axialkraft um 70 % gegenüber ihrem Maximalwert reduziert ist.
Unter Berücksichtigung der Verstärkung ändert sich die Form der Wechselwirkungskurve, allerdings nicht grundlegend. Um solche Diagramme zu sehen, können Sie im Internet nach dem Begriff „Column Interaction Curve“ suchen.
Dekohäsion
Die Dekohäsion zwischen zwei verbundenen Oberflächen wird in der Regel als eine Kombination aus Zugversagen und Scherversagen betrachtet. Die lasttragende Kapazität wird in diesem Fall meist durch die Bruchzähigkeit für Modus I (Zug) und Modus II (Scherung) beschrieben, G_{\mathrm {Ic}} und G_{\mathrm {IIc}}.
Eine der ersten Vorschläge für eine Interaktionsregel zur Beschreibung der Dekohäsion im Mixed-Mode war ein Potenzgesetz,
In diesem Fall müssen die Exponenten \alpha und \beta mit Experimenten abgeglichen werden. Es gibt kein Grundprinzip, auf das man sich stützen kann. Dieses Modell kann mit zwei Parametern (\alpha und \beta) mit den Werten G_{\mathrm {Ic}} und G_{\mathrm {IIc}} aus Einzelmodus-Experimenten betrachtet werden. Alternativ können alle vier Parameter verwendet werden, um die bestmögliche Übereinstimmung mit einer Reihe von Experimenten mit unterschiedlichen Moduskombinationen zu erzielen. In diesem Fall stimmen G_{\mathrm {Ic}} und G_{\mathrm {IIc}} nicht genau mit dem Ergebnis reiner Zug- oder Scherprüfungen überein.
In vielen Fällen passt das Potenzgesetz nicht gut genug zu den Messungen. Das Benzeggagh-Kenane-Kriterium (B-K-Kriterium) ist ein weiteres bekanntes Interaktionsgesetz:
Die Auslegung dieser Regel ist nicht eindeutig. Sie besagt, dass die Summe der angewandten Energiefreisetzungsraten der Modi I und II einer effektiven Bruchzähigkeit G_{\mathrm {c}} bei Versagen entspricht:
Die effektive Bruchzähigkeit ist eine gewichtete Summe aus G_{\mathrm {Ic}} und G_{\mathrm {IIc}}, wobei die Gewichtung vom Verhältnis zwischen den aufgebrachten Lasten abhängt. Es ist leicht zu erkennen, dass für den reinen Modus I oder den reinen Modus II die Kriterien für den Einzelmodus wiederhergestellt sind. Um die Auswirkungen des B-K-Kriteriums zu verstehen, kann eine Wechselwirkungskurve aufschlussreich sein.
Wenn die unidirektionalen Stärken gemessen wurden, muss nur ein Parameter mit den Experimenten übereinstimmen, nämlich der Exponent \eta. Alternativ können für eine bessere Kurvenanpassung alle drei Parameter verwendet werden.
Die Interaktionskurve kann mit einem die Belastung beschreibenden Parameter parametrisiert werden,
R variiert zwischen 0 (reiner Modus I) und 1 (reiner Modus II).
Das Verhältnis zwischen Scher- und Zugbruchzähigkeit sei \kappa,- so dass
Für gewöhnlich ist \kappa < 1.
Durch einige Umstellungen lässt sich das B-K-Kriterium dann in einer dimensionslosen Form schreiben als entweder
oder
Dies kann als parametrische Beschreibung der Interaktionskurve betrachtet werden, wobei R als Parameter dient.
In der folgenden Tabelle sind die Materialparameter für vier verschiedene Materialien sowohl für das B-K-Kriterium als auch für das Potenzgesetz angegeben. Die Daten stammen aus Ref. 2. Die Werte für die Bruchzähigkeit, G_{\mathrm {Ic}} und G_{\mathrm {IIc}}, sind für beide Modelle nicht identisch. Die Bruchzähigkeitswerte wurden in die Gesamtkurvenanpassung einbezogen.
| Material | \kappa | \eta | \alpha | \beta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,147 | 1,75 | 0,17 | 4,8 |
| 2 | 0,0785 | 2,35 | 6,0 | 6,0 |
| 3 | 0,0182 | 1,39 | 0,49 | 3,9 |
| 4 | 0,783 | 0,63 | 2,1 | 0,62 |
Diese Daten sind nachfolgend als Interaktionskurven in einem Plot dargestellt. Die Kurven für das Potenzgesetz wurden entsprechend der Differenz der Bruchzähigkeit zwischen den Modellen skaliert. Aus diesem Grund enden die Graphen für das Potenzgesetz nicht bei einem Wert von 1.
 Interaktionsdiagramme für die Dekohäsion im Mixed-Mode bei vier verschiedenen Materialien. Die durchgezogenen Linien zeigen das B-K-Kriterium und die gestrichelten Linien das Potenzgesetz-Kriterium für dasselbe Material.
Interaktionsdiagramme für die Dekohäsion im Mixed-Mode bei vier verschiedenen Materialien. Die durchgezogenen Linien zeigen das B-K-Kriterium und die gestrichelten Linien das Potenzgesetz-Kriterium für dasselbe Material.
Die Interaktionsdiagramme weisen einige überraschende Eigenschaften auf, die sich aus ihren individuellen mathematischen Eigenschaften ergeben. In dieser Darstellung wird deutlich, dass die Vorhersagen für dasselbe Material je nach verwendetem Modell erheblich voneinander abweichen können.
Ein Beispiel für die Anwendung des B-K-Kriteriums zur Modellierung von Dekohäsion ist im Tutorial-Modell Mixed-Mode Debonding of a Laminated Composite zu sehen.
Ermüdung
Bei der Bewertung des Risikos eines Ermüdungsversagens wird in der Regel davon ausgegangen, dass die zulässige Spannungsamplitude von der mittleren Spannung abhängt. Eine hohe mittlere Zugspannung verringert die zulässige Spannungsabweichung. Dabei werden mehrere Regeln angewendet, die zu unterschiedlichen Wechselwirkungskurven zwischen mittlerer Spannung und Spannungsamplitude führen. Drei der gängigsten Regeln heißen Goodman, Gerber und Soderberg.
Wenn die zulässige Amplitudenspannung \sigma_{\mathrm a} und die mittlere Spannung \sigma_{\mathrm m} heißen, dann besagen diese Regeln das Folgende:
Goodman:
Gerber:
Soderberg:
Die zulässige Spannungsamplitude wurde durch die Dauerfestigkeitsgrenze bei mittlerer Spannung von Null normiert, \sigma_{\mathrm a0}. \sigma_{\mathrm u} und \sigma_{\mathrm y } bezeichnen die Höchstspannung bzw. die Fließspannung. Diese Regeln lassen sich als Wechselwirkungskurven veranschaulichen.
 Wechselwirkung zwischen Spannungsamplitude und mittlerer Spannung für die Ermüdungsbewertung. Die Achse der mittleren Spannung wird durch die Bruchspannung normiert, wobei die Bruchspannung als 30 % größer als die Fließspannung angenommen wird.
Wechselwirkung zwischen Spannungsamplitude und mittlerer Spannung für die Ermüdungsbewertung. Die Achse der mittleren Spannung wird durch die Bruchspannung normiert, wobei die Bruchspannung als 30 % größer als die Fließspannung angenommen wird.
Sicherheitsfaktoren
Bei einem Versagenskriterium ist es üblich, einen einzigen Sicherheitsfaktor, eine Sicherheitsmarge oder eine ähnliche Größe anzugeben. Dies ist natürlich sinnvoll, aber nicht immer trivial. In den meisten Fällen soll ein Sicherheitsfaktor angeben, um wie viel die Last skaliert werden kann, bis ein Versagen eintritt. Bei Interaktionsdiagrammen geht es jedoch darum, dass es zwei unabhängige Quellen gibt. Mit der Notation von Versagen durch f( \xi, \eta ) = 1 wird der sichere Zustand f( \xi_0, \eta_0) = q < 1 betrachtet. Es gibt mindestens drei sinnvolle Definitionen für einen Sicherheitsfaktor s:
- Sicherheitsfaktor gegen Erhöhung der ersten Last bei konstanter zweiter Last: f( s\xi_0, \eta_0) = 1
- Sicherheitsfaktor gegen Erhöhung der zweiten Last bei konstanter erster Last: f( \xi_0, s\eta_0) = 1
- Sicherheitsfaktor gegen eine proportionale Erhöhung der beiden Lasten: f( s\xi_0, s\eta_0) = 1
In den meisten Fällen erfordert die Berechnung des Sicherheitsfaktors nach einer dieser drei Beziehungen die Lösung einer nichtlinearen Gleichung.
Als Beispiel wird angenommen, dass der Träger im ursprünglichen Beispiel bis zu einem Niveau belastet ist, bei dem gilt
In der folgenden Abbildung sind die drei Interpretationen von Sicherheitsfaktoren grafisch dargestellt. Das Interaktionsdiagramm kann leicht zur grafischen Ermittlung von Sicherheitsfaktoren verwendet werden, ohne dass Gleichungen gelöst werden müssen.
 Interaktionsdiagramm mit drei verschiedenen Arten von Sicherheitsfaktoren.
Interaktionsdiagramm mit drei verschiedenen Arten von Sicherheitsfaktoren.
In diesem Fall ergeben die drei Gleichungen für den Sicherheitsfaktor
Isobologramme
Betrachten wir nun die Verwendung von Interaktionsdiagrammenaußerhalb der Strukturmechanik. Isobologramme werden verwendet, um die Wechselwirkungen zwischen Arzneimitteln für medizinische Zwecke zu ermitteln.
Zwei gleichzeitig verabreichte Medikamente können die Wirkung des jeweils anderen verstärken. Dies wird als „Synergie“ bezeichnet. Es ist jedoch auch möglich, dass sie sich gegenseitig aufheben, was „Antagonismus“ genannt wird. Synergistische Effekte können wünschenswert sein, da sie zu einer Verringerung der Dosis führen können, was wiederum weniger Nebenwirkungen zur Folge haben kann.
Dies lässt sich natürlich auch auf die Toxizität anwenden, wenn die Mischung zweier toxischer Substanzen eine Wirkung hervorruft, die stärker oder schwächer ist als die Summe der beiden einzelnen Wirkungen.
Ein Isobologramm ist ein Interaktionsdiagramm zwischen zwei Substanzen, die die zur gleichen Wirkung führenden Kombinationen zeigt. Wie üblich ist die Kurve normiert. In der folgenden Abbildung sind die Grundformen von Isobologrammen dargestellt.
 Isobologramme für drei verschiedene Arten von Arzneimittelwechselwirkungen.
Isobologramme für drei verschiedene Arten von Arzneimittelwechselwirkungen.
Abschließende Bemerkungen
Interaktionsdiagramme sind leistungsstarke Werkzeuge, um die kombinierte Auswirkung zweier Vorgänge sowohl aus qualitativer als auch aus quantitativer Perspektive zu verstehen.
Es scheint, dass die meisten strukturellen Versagenskurven antagonistisch sind und dass es in der Regel einfacher ist, zwei unterschiedliche Lasten zu erhalten, als es eine reine Addition vermuten lässt. Aber trifft das immer zu? Ich kann diese Frage nicht beantworten, aber wenn Sie gute Gegenbeispiele haben, schreiben Sie gerne einen Kommentar. Tatsächlich zeigen einige der früheren Diagramme zur Dekohäsion in einem Teilbereich ein synergetisches Verhalten. Dies kann jedoch ein Artefakt aus der Kurvenanpassung sein. Jedes Potenzgesetz mit einem Exponenten <1 fällt teilweise unter die additive Linie.
Referenzen
- 1. MIL-HDBK-5H, MILITARY HANDBOOK: METALLIC MATERIALS AND ELEMENTS FOR AEROSPACE VEHICLE STRUCTURES, 1998; http://everyspec.com/MIL-HDBK/MIL-HDBK-0001-0099/MIL_HDBK_5H_1804/
- 2. J.R. Reeder, “3-D Mixed Mode Delamination Fracture Criteria – An Experimentalist’s Perspective,” NASA Langley Research Center, 2006; https://ntrs.nasa.gov/citations/20060048260

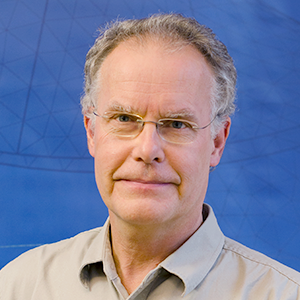




Kommentare (0)